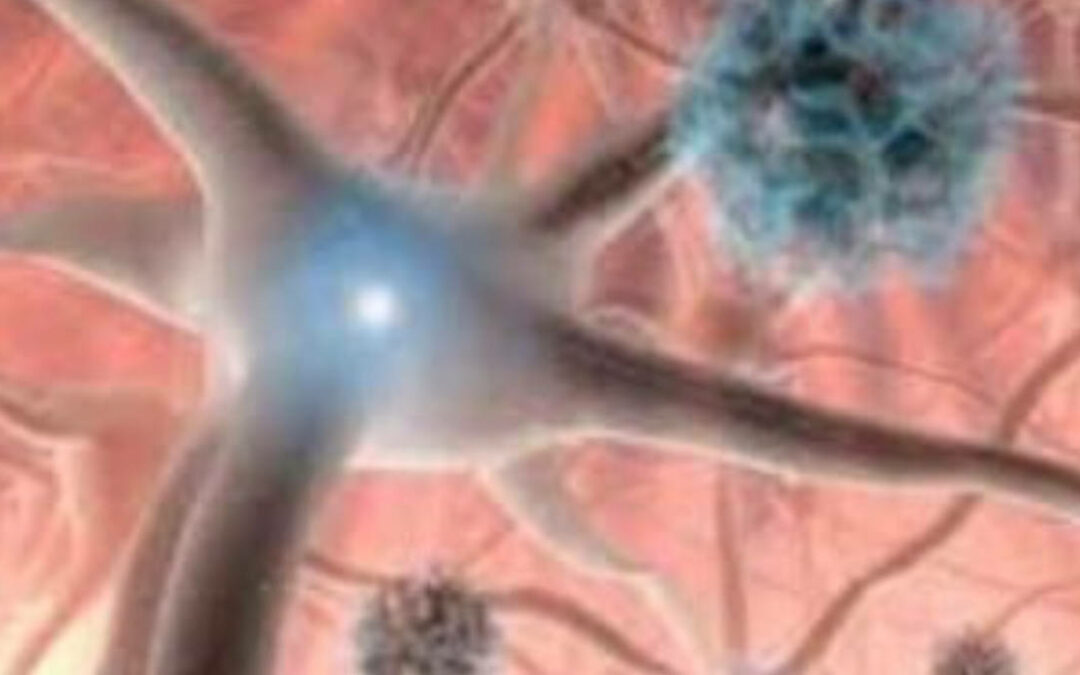Heilung ist immer Selbstheilung – Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther
Aus neurobiologischer Perspektive ist jede Erkrankung Ausdruck einer Überforderung der im Organismus angelegten Fähigkeiten, eine aufgetretene Störung seines inneren Gleichgewichts durch geeignete Reaktionen auszugleichen.
Meist kommt es unter solchen Bedingungen zur Aktivierung von Notfallreaktionen, die, wenn sie nicht durch langfristig tragfähige Lösungen ersetzt werden, zu maladaptiven, zunächst funktionellen und nachfolgend auch strukturellen Veränderungen führen.
Vor allem Letztere sind später nur schwer wieder auflösbar. Sie werden zum Ausgangspunkt sekundärer Anpassungsprozesse, die ihrerseits stabilisierend auf die primäre maladaptive Veränderung wirken.
Der so erreichte Zustand zeichnet sich durch eine eingeschränkte Reagibilität und Flexibilität der inneren Organisation des betreffenden Organismus aus und wird als chronische Erkrankung bezeichnet. Im Gegensatz zu einer akuten Erkrankung kommen die als Selbstheilungskräfte bezeichneten Reaktionen des Organismus zur Wiederherstellung seiner inneren Balance hier nur noch in eingeschränktem Umfang zur Wirkung. Auch sie sind in ihrer Fähigkeit, die primäre Störung zu erkennen und sie mit geeigneten Mitteln zu beheben, an die durch diese Störung ausgelösten Veränderungen angepasst. Die Störung wird entweder nicht mehr erkannt oder es wird nicht mehr adäquat darauf reagiert.
Heilung kommt nicht von außen
Medizinische Interventionen können dazu beitragen, die funktionellen oder strukturellen Veränderungen zu korrigieren – und damit einen Impuls für heilsame Regenerations- und Reorganisationsprozesse setzen. Sie können auch dazu beitragen, das Ausmaß und die Intensität maladaptiver Reaktionen auf eine primäre Störung der inneren Organisation des Organismus einzudämmen. Aber sie können keine Heilung bewirken.
Wie gut und wie schnell eine Person nach einer derartigen Störung wieder zu gesunden in der Lage ist, hängt deshalb ganz entscheidend davon ab, ob und wie effektiv es ihr gelingt, ihre eigenen Selbstheilungskräfte zu reaktivieren. Niemand kann einen anderen Menschen gesund machen. Jede Heilung ist daher immer und grundsätzlich Selbstheilung. Die ärztliche Kunst besteht darin, diesen Prozess der Selbstheilung zu unterstützen.
Selbstheilung: Ausgangspunkt limbisches System
In viel stärkerem Ausmaß als bisher angenommen, spielen für die Unterdrückung wie auch für die Reaktivierung von Selbstheilungsprozessen zentralnervöse Regelmechanismen für die integrative Kontrolle körperlicher Prozesse eine entscheidende Rolle.
Die zentralnervösen integrativen Regulationsprozesse sind in den älteren, tiefer liegenden Bereichen des Gehirns, insbesondere im Hirnstamm lokalisiert. Diese dort schon während der pränatalen Phase der Hirnentwicklung herausgeformten neuronalen Netzwerke und Regelkreise sind in ihrer Funktionsweise jedoch sehr leicht störbar durch übergeordnete, limbische, kortikale und insbesondere präfrontale Einflüsse.
Aus diesem Grund ist es nur möglich, die Selbstheilungskräfte eines Patienten wieder zu reaktivieren, wenn es gelingt, die im Verlauf einer Erkrankung entwickelten Vorstellungen, Gefühle und Haltungen des betreffenden Patienten so zu verändern, dass die durch die Gedanken und Vorstellungen, die Gefühle und die Haltungen des Erkrankten erzeugten Störungen der tiefer liegenden, für die integrative körperliche Regulation verantwortlichen neuronalen Netzwerke aufgelöst oder zumindest in ihrer Wirkung abgeschwächt werden.
Angst verhindert Selbstheilung
Angst ist das mit Abstand stärkste Gefühl, das über die Aktivierung neuronaler Netzwerke des Limbischen Systems, speziell der Amygdala, die im Hirnstamm angelegten Regelsysteme für die integrative Steuerung körperlicher Reaktionen und damit die Selbstheilungskräfte des Organismus zu stören vermag.
Ob und in welchem Ausmaß ein Patient auf die von ihm wahrgenommenen Veränderungen seines inneren Gleichgewichtes, also auf bestimmte Symptome einer Erkrankung mit Angst reagiert, hängt davon ab, wie er diese Wahrnehmungen bewertet. Diese Bewertungen erfolgen immer subjektiv auf der Grundlage der von diesem Patienten bisher gemachten Erfahrungen.
Verankert sind diese Erfahrungen in Form gebahnter synaptischer Verschaltungsmuster im präfrontalen Kortex. Erfahrungen zeichnen sich gegenüber erlernten Wissensinhalten dadurch aus, dass sie „unter die Haut“ gehen, also mit den in der betreffenden Situation gleichzeitig aktivierten Netzwerken für emotionale Reaktionen und die Regulation körperlicher Prozesse verkoppelt werden.
Erfahrungen sind deshalb in Form miteinander verknüpfter kognitiver, emotionaler und körperlicher neuronaler Netzwerke und Regelkreise im Gehirn verankert. Sie werden aus diesem Grund immer gleichzeitig als eine bestimmte Erinnerung oder Vorstellung erlebt, die mit einem bestimmten Gefühl und einer bestimmten Körperreaktion (somatische Marker) verbunden ist.
Als Integral oder Summe der bisher von einer Person gemachten Erfahrungen lässt sich das beschreiben, was im allgemeinen Sprachgebrauch als innere Haltung oder innere Einstellung umschrieben wird. Es handelt sich hierbei um ebenfalls im präfrontalen Kortex verankerte Metarepräsentanzen von subjektiv gemachten Erfahrungen.
Ereignisse werden subjektiv bewertet
Diese Einstellungen und Haltungen sind entscheidend für die subjektive Bewertung eines Ereignisses, im Fall einer Erkrankung also einer wahrgenommenen Veränderung auf körperlicher Ebene. Und diese subjektive Bewertung ist ausschlaggebend dafür, ob eine Angst- und Stressreaktion ausgelöst wird oder nicht, ob der Patient die Symptome wahrnimmt oder unterdrückt, ob er einen Arzt aufsucht oder nicht, ob er eine bestimmte Behandlung annimmt oder ablehnt, und nicht zuletzt, ob er an seine Gesundung glaubt und sich darum bemüht oder ob er die Erkrankung passiv erduldet oder gar aktiv aufrechterhält.
Diese im präfrontalen Cortex eines Menschen verankerten Haltungen sind schwer veränderbar. Weil sie an Gefühle und körperliche Reaktionen gekoppelt sind, bleiben rein kognitive Interventionen (Aufklärung, Belehrung, Beschreibungen etc.) meist ohne nachhaltige Wirkungen, wenn die emotionalen Anteile nicht ebenfalls gleichzeitig aktiviert werden.
Gleichermaßen bleiben emotionale Interventionen (Zuwendung, Mitgefühl, Fürsorge) meist ebenso wirkungslos, solange die kognitiven Anteile dabei nicht ebenfalls verankert werden. Eine nachhaltig wirksame Veränderung einmal entstandener Haltungen lässt sich daher nur herbeiführen, wenn es gelingt, den betreffenden Patienten einzuladen, eine neue, andere Erfahrung zu machen.
Eine Einladung zu neuen Erfahrungen
Ob ein Arzt in der Lage ist, einen Patienten einzuladen und zu ermutigen, solch eine neue Erfahrung machen zu wollen, hängt von der Haltung und Einstellung des betreffenden Arztes ab. Sie entscheidet über die Art der therapeutischen Beziehung, die sich zwischen Arzt und Patient herausbildet, und diese therapeutische Beziehung ist ausschlaggebend dafür, ob die vom Arzt eingeleiteten therapeutischen Interventionen dazu führen, die Selbstheilungskräfte des Patienten zu reaktivieren oder nicht.
Das Denken wird in unserem Kulturkreis noch immer als die wichtigste Funktion des menschlichen Gehirns betrachtet. Descarte`s „cogito, ergo sum“, ich denke, also bin ich, ist Ausdruck und Ausgangspunkt dieser Vorstellung. Interessanterweise wird diese Überzeugung in den letzten Jahren durch neuere Erkenntnisse der Hirnforschung immer stärker in Frage gestellt.
Wie die Neurobiologen inzwischen zeigen konnten, strukturiert sich unser Gehirn primär anhand der während der frühen Phasen der Hirnentwicklung aus dem eigenen Körper zum Gehirn weitergeleiteten Signalmuster. Es sind also eigene Körpererfahrungen, die die Organisation synaptischer Verschaltungsmuster in den älteren, tiefer liegenden Bereichen des Gehirns lenken.
Frühe Hirnstrukturen entstehen ohne das Denken
Und die primäre Aufgabe dieser bereits vor der Geburt und während der frühen Kindheit herausgeformten Hirnbereiche ist die Integration, Koordination und Harmonisierung der im Körper ablaufenden Prozesse, die Lenkung und Steuerung motorischer Leistungen beim sich Bewegen, beim Singen, Tanzen, und später auch bei Sprechen.
Erst danach werden auf der Grundlage dieses Fundaments die in der Beziehung des Kindes zur Außenwelt, insbesondere zu seinen Bezugspersonen gemachten Beziehungserfahrungen zur wichtigsten strukturierenden Kraft für die sich in den ausreifenden Hirnstrukturen herausformenden neuronalen Verschaltungsmuster. Jetzt erst wird die Gestaltung von Beziehungen zur äußeren Welt und hier in erster Linie zu den primären Bezugspersonen zur wichtigsten Aufgabe des sich entwickelnden Gehirns.
Das Denken spielt während dieser frühen Phasen der Hirnentwicklung noch keine Rolle, das Gehirn wird noch ausschließlich durch eigene, am eigenen Körper und in der unmittelbaren Beziehung zu den Objekten und Personen in der Außenwelt gemachte Erfahrungen strukturiert.
Erst mit dem Spracherwerb und der sich parallel dazu herausbildenden Fähigkeit zum symbolischen Denken gewinnen nun auch die eigenen, selbst entwickelten Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen eine zunehmende, stärker werdende strukturierende Kraft für die weitere Ausreifung neuronaler Verschaltungsmuster in den jeweiligen, sich am langsamsten entwickelnden und komplexesten Bereichen des Kortex, vor allem des präfrontalen Kortex, dem Frontallappen des Großhirns.
Aber auch diese eigenen Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen sind kein Selbstzweck, sondern dienen einer nun für den Rest des Lebens fortwährend und immer wieder neu zu bewältigenden Aufgabe: der Stabilisierung all dessen, was die betreffende Person als ihr zugehörig betrachtet, was in ihren Augen und aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen für die Aufrechterhaltung ihrer Identität als wichtig, brauchbar und nützlich betrachtet wird.
Der Ursprung der eigenen Identität
Und jetzt erst wird deutlich, was Descarte`s Erkenntnis „ich denke, also bin ich“ wirklich bedeutet: Wenn ich aufhöre zu denken, löst sich automatisch all das auf, was ich bisher vermittels meiner Denkanstrengungen zur Stabilisierung meiner eigenen Identität unternommen habe.
Die allein durch das Denken aufrechterhaltene Vorstellung vom eigenen „Ich“ verschwindet. Was übrig bleibt, sind all jene Anteile der eigenen Identität, die nicht durch das eigene Denken aufrechterhalten werden, sondern durch die im Verlauf der bisherigen Entwicklung mit dem eigenen Körper und in der unmittelbaren Beziehung zu anderen Menschen und der äußeren Welt gemachten Erfahrungen.
Es ist ein befreiendes Gefühl zu spüren, wie es ist, wenn es einem gelingt, sich bzw. sein authentisches Selbst durch das Loslassen der ich-bezogenen Gedanken und Vorstellungen wiederzufinden.
Nur wenige Menschen in unserem Kulturkreis kennen dieses Gefühl. Die meisten haben Angst davor, sich in diesem Prozess des Loslassens zu verlieren.
Reaktivierung von Selbstheilungskräften
Jeder Mensch verfügt über ein breites Spektrum von Mechanismen, Reaktionen und Verhaltensweisen, die auf unterschiedlichen Ebenen angreifen und in jeweils spezifischer Weise dazu beitragen, Störungen des inneren Gleichgewichtes auszugleichen.
Ohne diese Selbstheilungskräfte wäre keine Wundheilung, keine Überwindung einer Infektion, keine Rekonstitution nach einer Operation also im weitesten Sinne keine Genesung von einer Erkrankung möglich.
Diese in jedem Patienten angelegten Selbstheilungskräfte können, wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, durch bestimmte Gedanken und Vorstellungen des Patienten, durch lebensgeschichtliche Erfahrungen und die daraus entstandenen Haltungen und inneren Einstellungen und die davon abgeleiteten subjektiven Bewertungen unterdrückt und an ihrer Entfaltung gehindert werden.
Medizinische Interventionen müssen daher, wenn sie nachhaltig wirksam sein sollen darauf abzielen und sich daran messen lassen, ob und wie effektiv sie dazu beitragen, die Selbstheilungskräfte des betreffenden Patienten zu unterstützen, bzw. zu reaktivieren.
Aus neurobiologischer Sicht geht es dabei in erster Linie darum, im präfrontalen Cortex verankerte, die Selbstheilungskräfte des Organismus unterdrückende Vorstellungen, Einstellungen und Haltungen zu verändern. Die diesen Vorstellungen, Einstellungen und Haltungen zugrundeliegenden neuronalen Netzwerke und synaptischen Verschaltungsmuster im präfrontalen Cortex sind lebensgeschichtlich später herausgebildet worden als die für die Regulation körperlicher Prozesse verantwortlichen Netzwerke und Verschaltungen in den tiefer liegenden, älteren Bereichen des Gehirns.
Selbstheilung integriert Erfahrungen
Aus diesem Grund ist die Reaktivierung bisher unterdrückter Selbstheilungskräfte bei einem Patienten immer dann möglich, wenn es dem betreffenden Patienten gelingt, etwas wiederzufinden, was er verloren hat oder wieder an etwas anzuknüpfen, was unterbrochen oder getrennt war.
Konkret heißt das, dem Patienten muss Gelegenheit geboten werden, Erfahrungen zu machen, die sein Kohärenzgefühl wieder stärken. Mit anderen Worten: Die im Lauf seines bisherigen Lebens gemachten Erfahrungen von Unverbundenheit, von Unvereinbarkeit, Unverständnis und Hilflosigkeit müssen durch solche Erfahrungen überlagert werden, die an ursprünglich, zumindest während der frühen Kindheit, vorgeburtlich oder postnatal gemachte Erfahrungen von Kohärenz, von Verbundenheit und von eigener Gestaltungsfähigkeit anknüpfen.
Dabei wird individuell anhand der lebensgeschichtlichen Erfahrungen und der daraus bei einem Patienten herausgeformten Haltungen abzuleiten und zu entscheiden sein, wie sich der betreffende Patient für welche therapeutischen Hilfestellungen am besten einladen, ermutigen und inspirieren lässt. Zum Spektrum therapeutischer Verfahren, die sich hierfür eignen und deren Effizienz inzwischen auch durch entsprechende Untersuchungen nachgewiesen ist, zählen …
- unterschiedliche Relaxationstechniken (Benson 1976, Dusek et al. 2006)
- Verfahren zur Stärkung der Selbstregulation (Kabat-Zinn et al. 1986, Miller und Rollnick 2002)
- meditative Techniken (Kabat-Zinn et al 1992, Astin 1997, Davidson 2003)
- verschiedene Verfahren zur Veränderung von Haltungen und Einstellungen aus dem Bereich des Lifestyle-Change-Management (Ockene et al. 1988, Ornish et al 1998, Michalsen et al 2005).
Umsetzungsprobleme
Nicht ohne Grund steht das Problem der Unterdrückung bzw. Reaktivierung der Selbstheilungskräfte des Patienten bisher nicht im Zentrum der medizinischen Ausbildung und der medizinisch-therapeutischen Praxis. Innerhalb des gegenwärtigen medizinischen Versorgungssystems der westlichen Industriestaaten stößt dieser Ansatz auf erhebliche Umsetzungsprobleme.
Um die Selbstheilungskräfte eines Patienten zu reaktivieren bedarf es einer eingehenden Kenntnis der Lebensgeschichte des Patienten. Der behandelnde Arzt braucht ausreichend Zeit, um herauszufinden, welche Erfahrungen der jeweilige Patient gemacht hat und welche Vorstellungen und Überzeugungen, welche Haltungen und inneren Einstellungen aufgrund dieser Erfahrungen entstanden sind.
Dazu bedarf es einer persönlichen Beziehung, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Um eine solche Beziehung aufzubauen, müsste der Arzt seinem Patienten in einer offenen, nicht durch diagnostische Befunde oder materielle Interessen geprägten, wertschätzenden und zugewandten Haltung begegnen. Nur so kann es dem Arzt gelingen, den Patienten einzuladen und zu ermutigen, eine neue Erfahrung machen zu wollen. Auf Seiten des Patienten müssten gegenwärtig noch weit verbreitete falsche Erwartungshaltungen ebenso wie negative Vorurteile abgebaut werden.
Ein neues ärztliches Selbstbild
Und auf Seiten der Ärzte wären fragwürdige Selbstbilder, vorschnelle Urteile und Bewertungen und ein Mangel an Einfühlungsvermögen in die Situation des Patienten zu überwinden.
Kostendruck, Zeitmangel und der Zwang zu diagnostischer Klassifikation und juristischer Absicherung, aber auch eine unzureichende Kenntnis salutogenetischer Prinzipien sind entscheidende Faktoren, die eine Fokussierung ärztlichen Handelns auf die Reaktivierung der Selbstheilungskräfte des jeweiligen Patienten gegenwärtig noch ganz entscheidend verhindern.
Dennoch besteht Hoffnung, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit ändert. Zum einen gibt es eine ganze Reihe medizinisch-therapeutischer Disziplinen — und hierzu zählt die Mind-Body-Medizin ebenso wie die naturheilkundlich orientierte Medizin — die bereits sehr stark auf die Reaktivierung der Selbstheilungskräfte ihrer Patienten ausgerichtet sind. Zum anderen wird der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen zwangsläufig dazu führen, dass in Zukunft verstärkt nach bisher unzureichend beachteten Potenzialen zur Kostenreduzierung vor allem bei medizinischen Langzeitbehandlungen gesucht werden muss.
Bei dieser Suche, so darf jetzt schon prognostiziert werden, wird man die enormen Kostenersparnisse nicht mehr allzu lange übersehen können, die automatisch entstünden, wenn es gelänge, die Selbstheilungskräfte der Patienten deutlich effektiver und nachhaltiger zu reaktivieren als bisher.
Über den Autor
Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Gerald Hüther ist Professor für Neurobiologe an der Universität Göttingen. Wissenschaftlich befasst er sich mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Angst und Stress und der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und populärwissenschaftlicher Darstellungen.